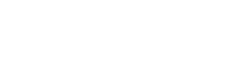EUS-gesteuerte Gallengangdrainage statt konventionellem Stenting via ERCP?
Alexander Meining, Ulm
Was Sie über diese Studien wissen sollten
Die endosonographische gesteuerte Punktion des Gallengangsystems mit anschließender Stenteinlage zur Therapie bei malignen Verschlussikterus hat sich mittlerweile zu einem „Renner“ der interventionellen Endoskopie entwickelt. Ein Beleg für diese These findet sich vor allem in der Quantität aber zwischenzeitlich auch Qualität der hierzu publizierten Studien. Waren vor einigen Jahren nur Kasuistiken ambitionierter Untersucher verfügbar, so gibt es nun auch multizentrisch, prospektiv-randomisierte Arbeiten. Das höchste Evidenzniveau wird folglich zumindest angepeilt.
Im letzten Jahr sind nun drei randomisierte Studien (zwei Arbeiten aus Südkorea, eine Studie aus den USA) erschienen mit dem Ziel eines prospektiven Vergleich der EUS-gesteuerten Gallengangsdrainage mit dem konventionellen Ansatz via ERCP mit anschließender transpapillärer Stenteinlage. Unabhängig von der Indikation, ob und wann ein EUS-gesteuertes Verfahren durchgeführt werden, hat das EUS-Verfahren zumindest den Vorteil, dass bei fehlender Manipulation an der Papille auch nicht mit dem Auftreten einer post-ERCP-Pankreatitis zu rechnen ist.
In der ersten Studie aus Südkorea (1) wurden nun 125 Patienten mit malignem Verschlussikterus randomisiert und entweder transpapillär via ERC (n=61) oder transmural via EUS (n=64) mittels Metallstents versorgt. Der technische und klinische Erfolg war in beiden Gruppen nahezu gleich und wurde mit jeweils 90,2% vs. 93,8%, bzw. 94,5% vs. 90% beziffert. Der EUS-Zugang erwies sich jedoch als überlegen im Sinne einer besseren Stentfunktion über die Zeit, demzufolge einer geringeren Re-Interventionsrate, einer höheren Lebensqualität der behandelten Patienten und interessanterweise auch hinsichtlich einer signifikant geringeren Nebenwirkungsrate (6,3 vs. 19,7%). Letzteres lässt sich v.a. durch das fehlende Auftreten einer post-ERCP-Pankreatitis nach EUS-Drainage erklären, während diese bei knapp einem Fünftel der mittels ERC behandelten Patienten auftrat.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kam die zweite Gruppe aus Südkorea (2). 30 Patienten mit malignem Verschlussikterus wurden 1:1 entweder mittels EUS oder via ERC therapiert. Erneut war die technische und klinische Erfolgsrate in beiden Gruppen nahezu gleich und wurde mit jeweils 100% vs. 93%, bzw. 93% vs. 100% beziffert. In dieser Studie gab es auch bzgl. der Nebenwirkungen keinen Unterschied, die Stentokklusionsrate war tendenziell in der EUS-Gruppe mit 2 vs. 4 Ereignissen besser. In der EUS-Gruppe kam es jedoch bei 2 Patienten zu einer Migration des Stents mit entsprechender Komplikation.
Zu guter Letzt gilt es die US-amerikanische Studie kurz zusammenzufassen (3). Die Autoren schlossen insgesamt 67 Patienten ein. 34 Patienten wurden mittels ERC, 33 Patienten mittels EUS therapiert. Der technische und klinische Erfolg war auch in dieser Studie in beiden Gruppen nahezu gleich und wurde mit jeweils 94,1% vs. 90,9%, bzw. 91,2% vs. 97% beziffert. Die Stentverschluss- und Re-Interventionsrate war gleich. Nebenwirkungen waren gering bis moderat und traten in 21,2% (EUS) und 14,7% (ERC) der behandelten Fälle auf (p=0,49).
Zusammengefasst lässt sich daher folgendes festhalten:
Drei wichtige Studien, die erfreulicherweise auch allen Standards einer prospektiven, randomisierten Studie gerecht werden. Was lernen wir daraus? In Anbetracht der ersten Studie von Paik et al. könnte man fast in Versuchung geraten, die ERC nun komplett durch einen EUS-gesteuerten Ansatz zu ersetzen. Hierfür reicht die Evidenz und die Ergebnisse der beiden anderen Studien jedoch nicht aus. Dieser Schritt wäre zu gewagt. Auch wurde in einer offenen italienischen Studie kürzlich ein Todesfall im Rahmen einer Blutung 17 Tage nach EUS-gesteuerter transbulbärer Choledochusdrainage berichtet (4). Dementsprechend halten sich auch die Autoren in ihren eigenen Schlussfolgerungen zurück und drücken etwas auf die Euphorie-Bremse. Eine post-ERCP-Pankreatitisrate von knapp 20% in der Studie von Paik et al. erscheint auch relativ hoch. Weiterhin ist die ERCP zu etabliert, um durch die EUS-gesteuerte Drainage jetzt abgelöst zu werden. Was jedoch definitiv hängen bleibt und auch berücksichtigt werden sollte, ist, dass man die transpapilläre Drainage via ERC nicht erzwingen sollte und lieber frühzeitig auf den endosonographischen Zugang ausgewichen werden sollte. Hier stellt sich dann jedoch die Frage, wer von den vielen Endoskopikern die eine ERCP routinemäßig durchführen, beherrscht denn auch die interventionelle Endosonographie ausreichend genug, um diesen Eingriff durchführen zu können? Leicht ist die EUS-Drainage sicherlich nicht immer zu bewerkstelligen und die bisherigen Daten stammen alle von Zentren mit entsprechender EUS-Expertise.
LITERATUR
- Paik WH, Lee TH, Park DH, Choi JH, Kim SO, Jang S, Kim DU, Shim JH, Song TJ, Lee SS, Seo DW, Lee SK, Kim MH. EUS-Guided Biliary Drainage Versus ERCP for the Primary Palliation of Malignant Biliary Obstruction: A Multicenter Randomized Clinical Trial. Am J Gastroenterol. 2018;113:987-997.
- Park JK, Woo YS, Noh DH, Yang JI, Bae SY, Yun HS, Lee JK, Lee KT, Lee KH. Efficacy of EUS-guided and ERCP-guided biliary drainage for malignant biliary obstruction: prospective randomized controlled study. Gastrointest Endosc. 2018;88:277-282.
- Bang JY, Navaneethan U, Hasan M, Hawes R, Varadarajulu S. Stent placement by EUS or ERCP for primary biliary decompression in pancreatic cancer: a randomized trial (with videos). Gastrointest Endosc. 2018;88:9-17.
- Anderloni A, Fugazza A, Troncone E, Auriemma F, Carrara S, Semeraro R, Maselli R, Di Leo M, D’Amico F, Sethi A, Repici A. Single-stage EUS-guided choledochoduodenostomy using a lumen-apposing metal stent for malignant distal biliary obstruction. Gastrointest Endosc. 2019;89:69-76.